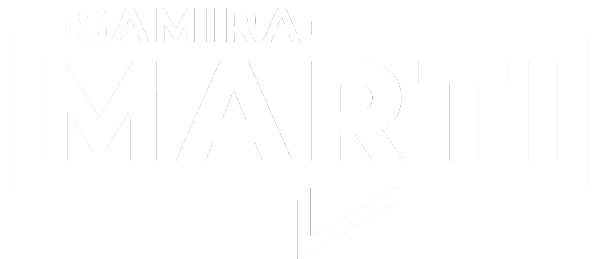Es gilt das gesprochene Wort.
Liebe Genossinnen und Genossen,
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
Liebe Anwesende,
Für die Bürgerlichen war der Schock riesig. Der 3. März wird Ihnen noch lange in den Knochen stecken. Wie gross ihre Panik war, hat man an den Reaktionen merken können.
«Egoisten! Idioten! Trottel!» haben Sie das Stimmvolk beschimpft. In allen Zeitungen und Fernsehsendungen dieses Landes haben Sie versucht klarzumachen: Das Ja zur 13. AHV-Rente war ein Unfall und sei dem Umstand geschuldet, dass die Bevölkerung am verdummen sei.
Viele haben mich gefragt, weshalb die so am Rad drehen. Die Antwort ist relativ simpel. Das Ja zur 13. AHV ist im besten Fall der Auftakt zu einer neuen politischen Epoche der Schweizer Politik. Und markiert damit vielleicht – so meine These – nichts weniger als das vorläufige Ende des Neoliberalismus. In der Schweiz!
Das Wort «Zeitenwende» hat ja Hochkonjunktur. Das ist kein Zufall, die Welt bewegt sich nun mal in rasantem Tempo, die Krisen überlappen sich. Da war die Pandemie, die diese Jahre des Umbruchs eingeläutet hat, der russische Angriffskrieg auf die Ukraine, die Erdbeben in der Türkei und Nordsyrien, die Extremwetterereignisse, die auf der ganzen Welt zunehmen, der Crash der Credit Suisse und der Krieg im Nahen Osten. Der Anstieg der Energiepreise, der die Inflation befeuert und damit die Kaufkraft-Krise in ganz Europa beschleunigt hat.
Die Reaktion der FDP, die Beleidigungen, die rechte Chefredaktoren auf den Titelseiten abgedruckt haben, die Weigerung von rechts, einen so deutlichen Volksentscheid wie die Annahme der 13. AHV-Rente umzusetzen, und vor allem ihre Wortwahl zeigt: Man kann die Wirkungsmacht unseres Erfolgs vom 3. März gar nicht überschätzen.
Zum ersten Mal wurde eine linke, sozialpolitische Initiative angenommen – und erst noch überdeutlich. Doch warum dominierte diese rechte Erzählung des sogenannt «egoistischen Jas»? Wieso diese aggressiven Diskreditierungsversuche? Weil es wohl für sie die einzige Waffe ist, um die aus ihrer Sicht gefährlichen Realität zu verwischen.
Denn das Ja zur 13. AHV-Rente ist der Beweis, dass das Solidaritätsband funktioniert. Dass unsere Bevölkerung solidarisch ist, solidarisch zwischen Land und Stadt und solidarisch zwischen Jung und Alt. Das wir als Gesellschaft uns darauf geeinigt haben, unser wichtigstes Sozialwerk auszubauen. Zu merken, dass Solidarität funktioniert – und alle davon profitieren – das ist revolutionär. Und es ist für die Rechte deshalb besonders gefährlich.
«There is no such thing as a society» Dieses berühmte Zitat von Margaret Thatcher, ehemalige Prime Ministerin der UK und eine der prägendsten Figuren beim Erstarken der neoliberalen Epoche, wurde einmal mehr widerlegt. In aller Deutlichkeit mit fast 60 Prozent der Stimmen. Doch, es gibt Solidarität! Doch, es gibt eine Gesellschaft. Und was für eine!
Dieser Umbruch hat sich schon vor ein paar Jahren abgezeichnet. Die Wirtschaftsverbände verlieren schon seit Jahren ihre Wirkungsmacht. Das Märchen der tropfenden Pfründe – der «trickle down effect» – hat langsam aber sicher ausgezaubert. Die Zeichen waren da. Die Annahme der Pflege-Initiative beispielsweise vor drei Jahren. Davor das Nein zur Unternehmenssteuerreform III, vor 7 Jahren. Seither haben wir diverse Steuerprivilegien für grosse Konzerne und Superreiche gemeinsam mit der Stimmbevölkerung verhindern können – immer gegen die gebetsmühlenartigen Versprechen der sogenannten Wirtschaftsverbände, der Konzernlobby.
Ja, Solidarität ist eine mächtige Waffe. Wir spüren es alle. Es ändert sich gerade etwas in den Köpfen und in den Herzen der Menschen. Was Economie Suisse sagt, ist Jahr für Jahr mehr Leuten schlicht und einfach egal.
Doch die Auseinandersetzung ist noch nicht beendet. Die Diskreditierungsversuche werden zunehmen. Die Rentner:innen werden nach wie vor in grossen Interviews und Fernsehsendungen von bürgerlichen Exponenten als Egoisten beschimpft, jetzt kommen dann die Familien dran, die die Prämienlast nicht mehr alleine stemmen können.
Ihre Spaltungsversuche sind immens – und funktionieren leider immer wieder. Die SVP erklärte die Annahme der 13. AHV-Rente damit, dass die Leute «weniger Geld ins Ausland und zu den Ausländern fliessen sehen wollen». Schuld waren also – wen überrascht es – einmal mehr die Asylsuchenden. Sie greifen mit mehreren Volksinitiativen die Grundrechte unserer Freund:innen an, die aus dem europäischen Ausland in die Schweiz migrieren, um hier zu leben und zu arbeiten. Sie attackieren die Personenfreizügigkeit– und zielen dabei auf den Lohnschutz und die vielen sozialen Rechte, die zu den zentralen Errungenschaften der linken, solidarischen, gewerkschaftlichen Kräfte gehören.
Die SVP hat kein Problem mit der Zuwanderung. Sie wollen Arbeitskräfte. Aber sie wollen keine Menschen. Menschen mit Familien. Menschen, die grundlegende Rechte haben. Das Recht, für die gleiche Arbeit den gleichen Lohn zu erhalten. Das Recht, ihre Kinder aufwachsen zu sehen. Das Recht, nach einem Schicksalsschlag auf das soziale Netz zurückzugreifen, das sie mit ihren Steuern mitfinanzieren. Das Recht, dort wo sie arbeiten, zu leben, mit allem, was zum Leben dazu gehört. So auch das Recht, politisch mitbestimmen zu dürfen.
Sie wollen die Zugewanderten entmenschlichen. Sie wollen die Zeit zurückdrehen. Zurück in die Zeiten, als italienische Gastarbeiter ihre Kinder und Frauen in Baracken am Stadtrand verstecken mussten, zurück zum Saisonniers-Status, zurück in eine Zeit, in der die Löhne der Zugewanderten und die Löhne der Inländischen Arbeitskräfte gegeneinander ausgespielt werden wurden, zurück in die Zeit der Dumpinglöhne, zurück in die Zeit der Spaltung der Arbeiter- und Arbeiterinnenbewegung.
Thomas Aeschi hat es einmal in einer Arenasendung selbst gesagt: Er sagte: «Ich will nicht den durchschnittlichen Bulgaren mit seiner ganzen Familie, ich will den hochqualifizierten Inder.» Zurück also zu den Kontingenten, zurück zur Entmenschlichung ausländischer Arbeitskräfte, weg von den Menschenrechten und dem Schutz des Privat- und Familienlebens.
Es ist immer dieselbe Strategie:
Jung gegen Alt.
Stadt gegen Land.
Schweizer gegen Ausländer.
Immer mehr auch: Eingebürgerte gegen Eidgenossen.
Unser restriktives Einbürgerungsregime ist kein Zufall. Es hilft ihnen dabei, Kategorien zu erhalten, die gegeneinander ausgespielt werden können. Die Restriktionen im Ausländerrecht, die dazu führen, dass Menschen ohne Schweizer Pass kaum mehr Zugang zur Sozialhilfe haben, dienen wiederum dazu, die Gesellschaft zu spalten. Der grosse Teil der zwei Millionen Menschen in der Schweiz, die keinen Schweizer Pass haben, wären in anderen europäischen Ländern seit Jahren eingebürgert.
Die Solidarität gewinnt nur, wenn wir als Sozialdemokrati:nnen, als Gewerkschafter:innen, als Aktivist:innen klare Kante zeigen. Gegen die Kategorisierung von ganzen Bevölkerungsgruppen. Gegen die Trennungsversuche. Und zwar nicht nur zwischen Jung und Alt, oder Stadt und Land. Sondern eben auch zwischen jenen, die schon länger hier leben, und denen, die neu zu uns stossen.
Im politischen Alltag der nächsten Jahre wird sich die Auseinandersetzung zum Ende der neoliberalen Ära auch in der Finanzpolitik abzeichnen. Massgeblich wegen der Schuldenbremse. Die Schuldenbremse, die momentan dazu dient, notwendige Zukunftsinvestitionen zu verhindern, ist DAS Symbol des schwachen Staates. Seit den 1980er Jahren hat die restriktive Finanzpolitik die öffentliche Hand geschwächt. Die Schweizerische Schuldenbremse ist die Quasipersonifizierung dieser rechtsliberalen Strategie, möglichst viele Bereiche unseres Lebens ökonomischen Zwängen zu unterwerfen. Die Schuldenbremse also als Symbol des schwachen Staates dient als Sinnbild für die vermeintlich leeren Kassen, die den Staat künstlich kleinhalten.
Viele hoch politische Fragen wurden dadurch vermeintlich «entpolitisiert». «Wir würden ja gerne die Kaufkraft der Menschen schützen, aber leider können wir es uns nicht leisten.» – «Wir würden gerne die Ukraine beim Wiederaufbau helfen, aber leider lässt es die Schuldenbremse nicht zu.» – «Doof, dass die Kitas so teuer sind, aber das Leben ist kein Wunschkonzert.».
Die restriktive Finanzpolitik hat für die Rechte ganze Arbeit geleistet. Sie ist wohl die erfolgreichste Ausrede der institutionellen, bürgerlichen Politikelite für ihr Politikversagen. Die Verteilkämpfe, die unweigerlich entstehen – zwischen Bauern und Offizieren oder zwischen der Ukraine-Hilfe und der Entwicklungshilfe für den globalen Süden – befeuern die Spaltung der Gesellschaft. Und das wiederum schwächt die Solidarität, die für ihre politischen Rezepte so gefährlich ist.
Wenn ich zu Beginn gesagt habe, wir erleben das vermeintliche Ende des Neoliberalismus, dann muss ich mich etwas präzisieren: Wir stecken mitten in dieser Auseinandersetzung. Denn zum Ende des Neoliberalismus gehört ein starker Staat, der die wichtigsten Bedürfnisse der Bevölkerung sicherstellt. Bei hoher Qualität und günstigen Preisen – unser Service Public. Früher waren es die Post und die SBB, mit der sich ganze Generationen stolz identifizierten. Heute reicht das nicht mehr. Wir müssen den Service Public ins 21. Jahrhundert führen.
Es geht zum Beispiel darum, unser Leben auf eine Netto-Null-Welt einzustellen. Den Klimaschutz voranzutreiben. Die grossen Posten bei den CO2-Emissionen in der Schweiz sind grob gesagt: ein Drittel Verkehr, Ein Drittel Gebäude, ein Drittel Industrie. Es braucht massive öffentliche Investitionen für den klimaschonenden Umbau unserer gesamten Infrastruktur.
Es geht auch um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf: Die heutigen Angebote der externen Kinderbetreuung sind zu teuer und zu kompliziert. Auch das gehört zum Service Public des 21. Jahrhunderts.
Und es gehört dazu, ein Gesundheitswesen zu haben, das nicht nur eine hohe Qualität mit sich bringt, sondern vor allem für alle zugänglich und bezahlbar ist.
Alt-Bundesrätin Ruth Dreifuss hatte die Vision, dass kein Mensch in der Schweiz aus finanziellen Gründen auf eine notwendige medizinische Behandlung verzichten muss. Mit dieser Leitidee hat sie in bürgerlichen Verhältnissen das Versicherungsobligatorium und das System der Prämienverbilligungen eingeführt. Niemand soll sich wegen einer unvorhersehbaren Krebsdiagnose oder einem Herzleiden verschulden müssen.
Doch die steigenden Kopfprämien und die unzureichenden Prämienverbilligungen haben in den letzten Jahren dazu geführt, dass wir uns immer mehr von dieser Vision verabschiedet haben. Heute bezahlt eine Familie mit zwei erwachsenen Kindern in Ausbildung bis zu 2000 Franken monatlich für die Krankenkassenprämien – und da ist noch keine einzige Arztrechnung mit eingerechnet.
Immer mehr Menschen entscheiden sich für die höchste Franchisse – obwohl sie krank sind und wissen, dass sie die Arztrechnungen nicht bezahlen können. Jeder fünfte Haushalt kann eine unvorhergesehene Ausgabe von 2000.- nicht stemmen.
Wir erleben das Paradoxon, dass wir in der Schweiz zwar eines der besten Gesundheitswesen der Welt haben, aber immer mehr Menschen nicht nur von diesen medizinischen Spitzenleistungen, sondern auch von der Grundversorgung ausschliessen.
Im Juni werden wir darüber abstimmen, ob diese ungute Entwicklung gestoppt gehört oder nicht. Unsere Prämien-Initiative fordert eine Selbstverständlichkeit: Die Prämienexplosion muss ein Ende haben. Kein Haushalt sollte mehr als 10 Prozent des Einkommens für die Prämien ausgeben müssen.
Und die Bürgerlichen drehen schon wieder am Rad. Sie reden von vermeintlichen Steuererhöhungen und ignorieren dabei die Tatsache, dass diese Initiative keine Mehrkosten verursachen wird. Jeder einzelne Franken wird heute bereits bezahlt, und zwar von den Menschen mit tiefen und mittleren Einkommen, jenen Familien, die heute zwischen die Maschen fallen. Ihr Einkommen ist zu hoch, um Prämienverbilligungen zu erhalten, aber zu tief, um die ansteigende Prämienlast zu tragen.
Es ist also keine Frage von Mehrkosten. Wir wollen die finanzielle Last nur fairer verteilen. Es ist schlicht und einfach unverständlich, warum der Kellner mit einem Einkommen von knapp 4000 Franken gleich wie Prämien bezahlen muss wie die Chefärztin eines Privatspitals, die jedes Jahr ein Millionengehalt bezieht.
Diese unsoziale Kopfprämie können wir mit einem Ja zur Prämien-Initiative am 9. Juni brechen. Und wir setzen damit auch die institutionelle Politik unter Druck, endlich die Verschwendungen im Gesundheitswesen zu adressieren. Heute wird in Bern kein gesundheitspolitisches Geschäft beraten, ohne dass die mächtigen Lobbys der Krankenkassen, Versicherungen und Co. Ihre Pfründe sichern. Etliche bürgerliche Parlamentarier:innen sitzen in Verwaltungsräten und kassieren Jahr für Jahr hohe Entschädigungen dafür.
Nicht, weil sie die Geeignetsten für den Job wären. Viele haben keine Erfahrungen im Gesundheitswesen vorzuweisen. Ihr Dienst liegt darin, als sogenannte Volksvertreter im Parlament für die grossen Player im Gesundheitsmarkt einzustehen. Wer bezahlt denn heute die Kosten dieses Politikversagens? Wer bezahlt die Verschwendung, wenn Eingriffe stationär statt ambulant durchgeführt werden? Wer zahlt die vielen unnötigen Operationen bei Privatversicherten? Wer bezahlt die Millionensälare der spezialisierten Fachärzte? Die breite Bevölkerung. Nichts ist so sicher wie das Amen in der Kirche – ausser der Prämienanstieg, der jeweils im September mit grossem Bedauern angekündigt wird.
Mit dem 10-Prozent-Deckel schützen wir also nicht nur die Kaufkraft der Bevölkerung, sondern spornen die bürgerlichen Parteien auch an, endlich mitzuhelfen bei kostendämpfenden Massnahmen, die ohne Probleme und ohne negative Auswirkungen auf die Qualität der Gesundheitsversorgung umgesetzt werden könnten.
Ich glaube fest daran, dass wir diese Initiative gewinnen können. Nach dem Ja zur 13. AHV-Rente wären es dann bereits zwei sozialpolitische Volksinitiativen, die wir innert drei Monaten zum Fliegen bringen würden. Unvorstellbar, mit welchen Beschuldigungen dann die Bürgerlichen auf die Menschen losgingen. Man darf auf jeden Fall gespannt sein.
In diesem Abstimmungskampf und darüber hinaus werden wir alle eure Kräfte brauchen. Vereint durch die Überzeugung, den Krisen unserer Zeit nicht einfach hilf- und tatenlos ausgeliefert zu sein, und im Wissen darum, welche Kraft wir haben, wenn wir uns zusammenschliessen.
Welche Macht wir haben, wenn die Solidarität nicht nur ein 1. Mai-Slogan ist, sondern uns in unserem Handeln und in unseren politischen Kämpfen anführt und die breite Bevölkerung daran glaubt, dass Veränderung zum Guten möglich ist. Dieser Glaube macht uns grosszügig. Etwas verändert sich gerade – in den Herzen und Köpfen in unserem Land. Machen wir weiter so.